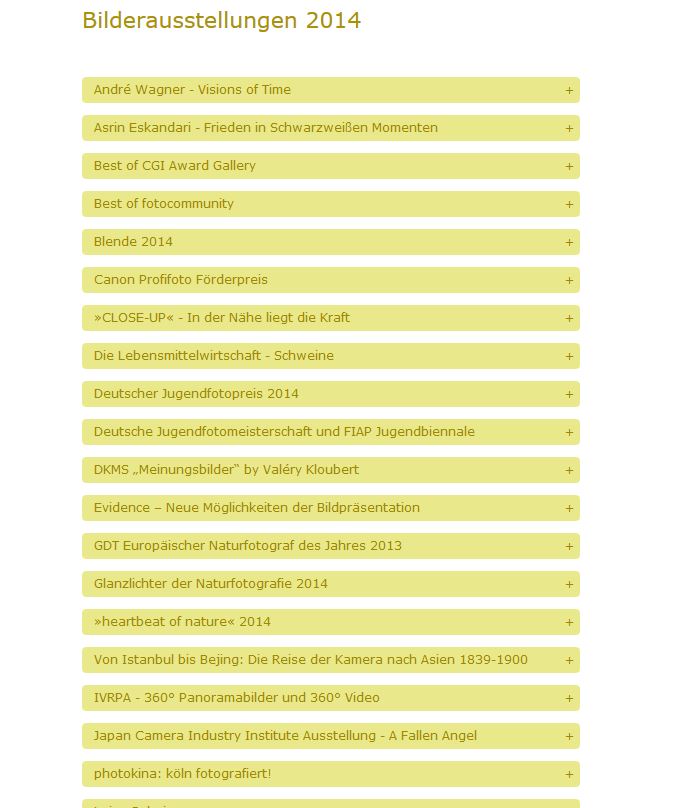„Unter der Photographie eines Menschen ist seine Geschichte wie unter einer Schneedecke begraben,“ schrieb Siegfried Kracauer 1927.
Ein guter Satz, denn unter einer Schneedecke sind die Dinge so verborgen, daß man sie nicht erkennen kann.
Was wir wirklich sind, sehen wir nicht.
Wir sehen nur, wie wir aussen sind.
Der Blick in die Augen als Spiegel der Seele läßt Dinge spüren, die aber eben nicht sichtbar sind.
Das Festhalten von Oberflächenerscheinungen läßt aber Rückschlüsse zu.
Dazu bedarf es aber Wissen um die Entstehung eines Fotos, die Biografie einer Person, die Situation, in der das Foto aufgenommen wurde und vieles mehr. Eine Fotografie muß einzuordnen sein. Da dies historisch und kulturell begrenzt ist, muß man diese Informationen hinzufügen, wenn es eindeutig sein soll.
Dann kann man die Oberfläche durchdringen und die Tiefe einer Fotografie verstehen.
Als Walter Benjamin 1936 in dem Essay „Der Erzähler“ darauf verwies, daß die Fotografie künftig die Rolle des Erzählers übernehmen wird, stellte er im Rückblick auf den Ersten Weltkrieg fest: „Es sei, so Benjamin, als ob ein Vermögen, das uns unveräußerlich erschien, das Gesichertste unter dem Sicheren, von uns genommen würde. Nämlich das Vermögen, Erfahrungen auszutauschen.“ Diesen Hinweis fand ich in einem Aufsatz von Martine Dancer.
So ist die Grenze der Fotografie das Sichtbare bzw. die Oberfläche.
Das ist besonders sichtbar beim Schminken.
Das Schminken soll die Oberfläche verändern, um so zu sein wie man nicht ist aber sein will.
Es kann auch der Versuch sein, das Innere zu zeigen, also äußerlich zu machen.
Die ganzen Wörter hier dienen nur dazu, die Grenze deutlich zu machen.
Die Grenze des Visuellen ist der Beginn des Wortes.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber Worte sagen das, was ein Bild nicht zeigen kann.
Bild und Text sind zusammen die runde Welt.